
Renaissance-Kachelofen
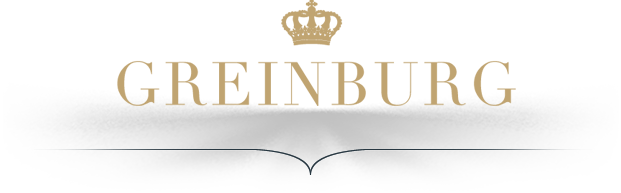
Renaissance-Kachelofen
Das Highlight im Jagdzimmer.
Wenn wir an wohlige Wärme in der guten Stube denken, haben viele von uns das Bild eines KACHELOFENS vor Augen. Genau so einer steht auch im Jagdzimmer der HERZOGLICHEN FESTRÄUME. Wohlige Wärme strahlt dieser aber leider nicht mehr aus, da er nur mehr als dekoratives Raumelement dient und somit nicht beheizt werden kann. Geheizt wird mit Fernwärme über Heizkörper, die, optisch verträglich, von Holztäfelungen verdeckt sind.
Der kupfergrüne und antimongelbe Kachelofen stammt aus den 1620ern – eine Zeit, in der GRAF MEGGAU der Besitzer der Greinburg war. Der dreiteilige Aufbau von Feuerkasten, Turm und Bekrönung wird von Kacheln geziert und von Friesen und Gesimsen gegliedert.
Die gelben Kreise der großen BLATTKACHELN sehen wie die Sonne oder wie Sonnenblumen aus. Die Trumfriese sind besonders schön gearbeitet, denn hier sind Putti zu erkennen, aus deren Füllhörnern allerlei Rankenwerk hervorsprießt. Prächtige Löwenköpfe rahmen die Friese auf allen Seiten.
Der krönende Abschluss wird von einer Reihe von Figuren mit Medaillons und Schildern gebildet, welche die „NOMINA SACRA“ IHS und MRA tragen.
Kachelöfen wie dieser zählten Jahrhunderte lang zum beherrschenden Element in heizbaren Räumen und erfuhren während dieser Zeit große optische Veränderungen. Erst im 14. Jahrhundert entwickelte sich der vollausgebildete Kachelofen, der mit farbig glasierten und plastisch ausgebildeten Kacheln schnell zum OBJEKT KÜNSTLERISCHER GESTALTUNG wurde. Beliebte Motive sind profane Darstellungen des höfischen Lebens, religiöse Motive, Fabelwesen und Wappen. Ähnliches kann man auch bei unserem Ofen erkennen.
Die Öfen, welche in den darauffolgenden Epochen des Barock und Rokoko entstanden, erfuhren eine große optische Veränderung und fügten sich somit der restlichen Innenausstattung ein. In den Herzoglichen Festräumen lässt sich diese Wandlung wunderbar mit weiteren Öfen in den folgenden Räumen nachvollziehen.
Wer intensiver in die Welt der Kachelöfen und der weiteren Kunstausstattung der Greinburg eintauchen möchte, sollte sich die EXPERTENFÜHRUNG „Vom Teppich bis zum Kronleuchter“ – nicht entgehen lassen. Die Termine finden Sie hier.
Jänner 2026










